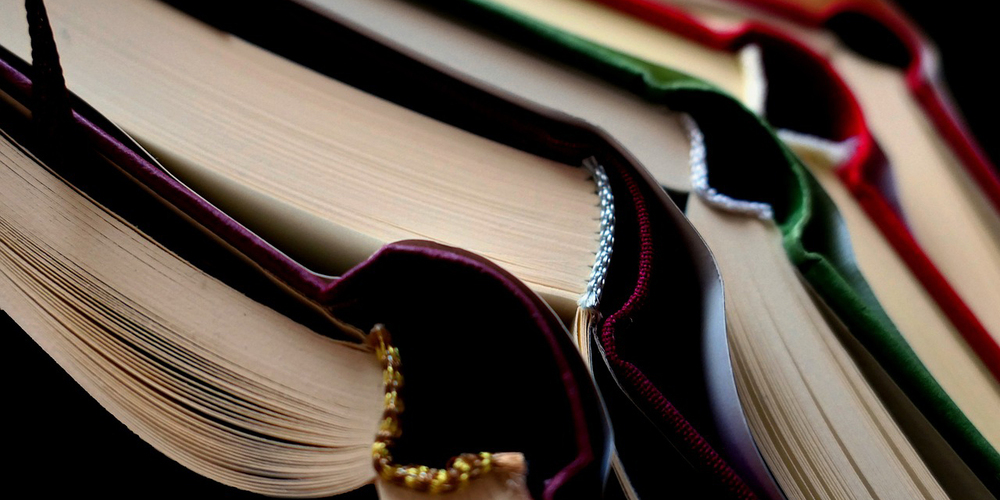Im Folgenden ein Überblick über die prämierten Maturarbeiten:
Fachbereich Sprachen
Alessia Miorin, L’occitan - qu’en reste-t-il en France aujourd’hui?
Noel Weber, Sprachgebrauch von fremdsprachigen Jugendlichen im diglossischen Schulkontext der Deutschschweiz
«L’occitan - qu’en reste-t-il en France aujourd’hui?» heisst der Titel von Alessia Webers Maturaarbeit. Occitan oder auch langue d’oc wird eine Sprache genannt, die vor allem im südlichen Teil von Frank-reich gesprochen wird. Hinweise zum Occitan oder okzitanischen Sprache fand Alessia Morin in einem Buch über neulateinische Sprachen, einer Gruppe von Sprachen, die sie generell interessiert. Der Text über die okzitanische Sprache hatte sie so fasziniert, dass sie beschloss, ihre Arbeit über diese wenig bekannte Sprache zu schreiben. Das Okzitanische ist, wie auch das «normale» Französisch, aus dem Vulgärlatein Galliens entstanden. Da ihm nie Unterstützung durch den Staat zum Erhalt und zur Förderung gewährt wurde, entwickelte es sich zu einem Dialekt, einer gesprochenen Sprache, die hauptsächlich in ländlichen Gegenden immer noch verbreitet ist. Es scheint, dass die Sprache das Schicksal vieler Dialekte teilt: In einer Zeit der Globalisierung, der zunehmenden Migration und der Tendenz der allgemeinen Verstädterung werden sie von den Hauptsprachen verdrängt oder einverleibt und verschwinden nach und nach. Miorins Arbeit überzeugte die Jury durch die präzise Sprache, die Abhandlung der geschichtlichen Entwicklung des Okzitanischen und dessen Verbreitung in Frankreich, sowie die Analyse der heutigen Situation: eine, im besten Sinne des Wortes, reife Arbeit.
Noel Webers Arbeit trägt den Titel «Sprachgebrauch von fremdsprachigen Jugendlichen im diglossischen Schulkontext der Deutschschweiz». Das Wort Diglossie hat griechische Wurzeln und bedeutet Zweisprachigkeit, wobei die beiden Sprachen in derselben Gesellschaft parallel zur Anwendung kommen, jedoch unterschiedliche Positionen einnehmen. Die «hohe» Sprache wird als Amtssprache gebraucht, und die »niedrige» Sprache, der Dialekt, wird hauptsächlich umgangssprachlich benutzt. In der Deutschschweiz wird die eine als Hochdeutsch betitelt, die andere als Mundart. Die Diglossie bedeutet ein grosses Problem für Migranten, die sich hier integrieren möchten, müssen sie doch zwei Fremdsprachen zeitgleich lernen. Noel Webers Ziel war die Untersuchung der Situation der Sprachförderung von fremdsprachigen Jugendlichen in der Schweiz im Allgemeinen und an der Kantonsschule im Speziellen. Ebenso sollten, wenn möglich, auch Lösungen zu einer besseren Sprachförderung an der Kantonsschule Schaffhausen aufgezeigt werden. Die Arbeit ist exzellent aufgebaut, die Analysen sind konzise und klar, und in einem ausgezeichneten Deutsch verfasst. All dies sowie die Interviews mit sechs fremdsprachigen Schülern der Kantonsschule
führen zu folgendem, nicht überraschenden, Fazit: Es braucht mehr Möglichkeiten mit einfachem Zugang zum Erlernen der deutschen Sprache sowie mehr Offenheit und Pragmatismus im Umgang mit Fremdsprachigen in unserer Gesellschaft.
Fachbereich Geistes- und Sozialwissenschaften
Prämierte Arbeiten:
Laurin Egger, Die Wirksamkeit des Strafrechts
Jasmin van den Hout, Jenseitsvorstellungen und Todesriten antiker Kulturen im Vergleich – Die Kelten, Wikinger, Römer und Christen
Hinter der Maturaarbeit von Laurin Egger steht das Vorhaben, die Wirksamkeit unseres Strafrechts zu analysieren. Im Zentrum steht die Leitfrage, welche Faktoren das Rückfallrisiko eines Straftäters beeinflussen bzw. welche Ursachen entscheidend sind für den Beginn bzw. den Abbruch einer kriminellen Laufbahn. Im Vordergrund stehen bei Jugendlichen die elterliche Kontrolle, Gewalterfahrung, häusliche Gewalt sowie delinquente Freundeskreise bis hin zur Bandenzugehörigkeit. Laurin Egger führt den Leser in das Strafrecht, das Strafprozessrecht, in das jeweils kantonal geregelte Strafvollzugsrecht und die Bewährungshilfe sowie in die jeweils gesetzlichen Grundlagen ein. Der Strafvollzug muss schliesslich eine gute Kombination aus Abschreckung, Resozialisierung und Gerechtigkeit darstellen. Hier stellt der Autor auch Verbesserungspotential des Strafrechtssystems fest. Im Hauptfokus steht die Rückfallquote von Straftätern und Straftäterinnen in den Kategorien Gewaltstraftat und Diebstahl. Dazu gibt es günstige und ungünstige Kriterien, die auf diese Quote Einfluss haben, wie zum Beispiel im günstigen Fall das Erlernen von Konfliktstrategien und die Einbindung im familiären und sozialen Bereich sowie andererseits im negativen Fall Therapieabbrüche, fortgesetzter Suchtmittelgebrauch und Rückkehr ins Mi-lieu. Die sehr illustrative und aufschlussreiche Biographie eines sog. Wiederholungstäters, das transkribierte Interview mit ihm sowie die Gespräche mit dem Ersten Staatsanwalt, dem Gefängnisaufseher und dem Bewährungshelfer gehen in die Tiefe und sind Zeugnis dafür, dass der Autor sich sehr viel Zeit für die Beantwortung der komplexen Fragen genommen hat. Es ist eine ausserordentlich erfreuliche Arbeit, die viele Facetten dieser Fragen beleuchtet und mit grossem Respekt und viel Empathie die richtigen Schlüsse daraus zieht. Es ist wohl ungewöhnlich, wenn sich eine noch junge Person mit dem Tod beschäftigt. Jasmin van den Hout erklärt bereits in ihrer Einleitung, warum sie sich mit der Beschäftigung des Menschen mit dem Tod befasst. Die Frage nach dem Danach wohnt wohl jedem Menschen inne, meist schon seit der Kind-heit, und das ist auch bei ihr so. Die Besonderheit dieser Arbeit liegt aber darin, die antiken Kulturen nach diesen Fragen zu konsultieren. Ein erster deskriptiver Teil behandelt die Lebensweise der Wikinger, Kelten, Römer und frühen Christen, deren Begräbnisriten, Grabbeigaben und Totenehrungen, und beschreibt deren Lebensweise, Religion, deren Götter, Opfergaben und die Funktion der Priester sowie die Vorstellung über die Schöpfung der Welt. Sei es nun Walhalla, die Anderwelt, das Elysium oder das Paradies, es bestehen durchaus Gemeinsamkeiten der grundsätzlich verschiedenen Völker bezüglich der Frage, was nach dem Tod kommt. Auch in der Schöpfungsgeschichte gibt es viele Gemeinsamkeiten, ebenso bei den Ritualen. In einer konzisen Tabelle stellt die Autorin die wesentlichen Merkmale der verschiedenen Religionen zusammen. Sei es nun Polytheismus oder Monotheismus, es gibt bei allen eine Art Weiterleben nach dem Tod, die Unsterblichkeit der Seele ist in jeder Kultur ein fester Bestandteil. Auch die Bestrafung nach dem Tod bei schlechtem Lebenswandel ist mindestens bei den Wikingern, Römern und Christen verankert in den Jenseitsvorstellungen. Nicht erstaunlich ist, dass es auch bei Opferkult und Begräbnisritualen zahlreiche Parallelen gibt. Sehr geistreich und mit viel Einfühlungsvermögen bringt Jasmin van den Hout am Schluss ihrer Arbeit ein philosophisches Essay über die Be-gründung dieser Jenseitsvorstellungen, die zutiefst menschlich sind und in denen die Hoffnung verborgen ist, die Angehörigen und Freunde wieder zu treffen. Diese Hoffnung ist zeitlos und wird bleiben, solange es Menschen gibt. Die fundierte Darstellung der Arbeit, die scharfsinnigen Beobachtungen und die persönlichen Schlüsse daraus machen diese Arbeit zu etwas Besonderem. Sie fand unsere ungeteilte Anerkennung.
Fachbereich Naturwissenschaften
Prämierte Arbeit:
Jonas Riesen, Entwicklung einer KI-unterstützten Lernapp
Künstliche Intelligenz (KI) als Helfer bei der Prüfungsvorbereitung - dank Jonas Riesen jetzt Realität. Als Maturaarbeit hat er die Lern-App «Studyflow» programmiert, die, gestützt auf KI, Texte, Notizen und Lernziele analysiert, zusammenfasst und Übungsmaterial zur Prüfungsvorbereitung generiert. Nebst der Programmierung einer zielorientierten und einfach zu benutzenden App, hat Jonas Riesen auch eine hervorragend geschriebene und strukturierte Arbeit eingereicht. Schritt für Schritt führt er die Leser durch den Entwicklungsprozess, die Designwahl und die Analyse der Nutzertests und erklärt dabei gekonnt Fachbegriffe und Entscheidungsprozesse. Die App ist gratis und sowohl für Android wie auch Apple verfügbar.
Fachbereich Technik und Wirtschaft
Prämierte Arbeiten:
Elena Knecht, Die Adaptionen des Schweizer Wintertourismus an die Folgen des Klimawandels – drei Fallbeispiele im Vergleich
Aaron Junker, Sprachassistent für Microsoft Cloud-Dienste programmieren
Die Auswirkungen des Klimawandels sind in vielen Bereichen spürbar, aber wohl nirgendwo eindrücklicher als in den Bergen, wo ein starkes Abschmelzen der Gletscher und des Permafrosts registriert wird und Niederschlag immer mehr in Form von Regen statt Schnee erfolgt. Das sich verändernde Klima hat also weitreichende Konsequenzen nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Wirtschaft und die Lebensgrundlage der Menschen insbesondere in den Wintertourismus-Destinationen. Genau dieser spezifischen Facette des Klimawandels hat sich Elena Knecht in ihrer Arbeit angenommen, nämlich der Frage, wie der Alpentourismus in den Schweizer Bergen mit den Folgen des Klima-wandels umgeht. Im theoretischen Teil werden der aktuelle Forschungsstand wie auch Trends und mögliche Anpassungsstrategien im Schweizer Alpen-Tourismus erläutert. In der eigentlichen Feldarbeit führt Elena Knecht Interviews mit den Verantwortlichen in drei unterschiedlichen Skigebieten zu den Auswirkungen des Klimawandels respektive zu den Strategien, wie dem Thema zu begegnen ist.
Mit ihrer Maturarbeit gelingt es Elena Knecht, ein relevantes und komplexes Thema aufzuarbeiten und mit grossem Aufwand attraktiv darzustellen. Die Arbeit ist logisch aufgebaut, hat eine klare Struktur, einen roten Faden, besticht formal, sprachlich und auch von ihrem methodischen Ansatz her. Und, last but not least, bietet sie dem Leser, der Leserin nachvollziehbare Schlussfolgerungen.
Aaron Junker hat, basierend auf künstlicher Intelligenz, einen Sprachassistenten entwickelt und pro-grammiert, der es erlaubt, die Produkte des Microsoft 365-Ökosystems per Sprachkommando zu steuern. Das entsprechende Programm hat er von Grund auf und selbständig entwickelt und im Microsoft-Store als eigene Applikation veröffentlicht. Sie kann unter der Bezeichnung «RED Voice Assistant» heruntergeladen werden.
Aaron Junker beschreibt ausführlich den Aufbau und die Funktionsweise, die benutzten Tools, Program-miersprachen und listet auch die veröffentlichten Versionen auf. Diese naturgemäss sehr praxisbezogene Maturarbeit besticht durch ihre Komplexität und entsprechend anspruchsvolle Umsetzung. Der Sprach-assistent funktioniert einwandfrei und verknüpft mehrere Komponenten in einem verteilten System, darunter ein vom Schüler selbst trainiertes Konversationsmodell, das auf künstlicher Intelligenz beruht. Die fast schon professionelle Software-Programmierung überzeugt durch ihre hohe Qualität – eine Einschätzung, die notabene unter anderem auch von einem Informatikdozenten der ZHAW bestätigt wird.
Fachbereich Kunst und Sport
Prämierte Arbeit:
Lara Wetter, Verbildlichung von physischem und psychischem Schmerz
Lara Wetter hat sich in berührender Art und Weise mit der Fragestellung «Wie können physisches und psychisches Leid verbildlicht werden?» auseinandergesetzt. Sie hat dazu verschiedene Werke von bekannten Künstlerinnen und Künstlern, u.a. das Gemälde «Die gebrochene Wirbelsäule» von Frida Kahlo, auf einem sehr reifen künstlerischen Niveau analysiert und jeweils mit einer persönlichen Würdigung versehen. Im praktischen Teil ihrer Arbeit malte Lara Wetter zwei beeindruckende Gemälde, in denen sie sich mit ihren eigenen Schmerzen und die dadurch entstandenen psychischen Beschwerden auseinandersetzte. Für die Darstellung ihrer beiden Gemälde wählte Lara zwei Holzflächen mit einem tiefen Rand, um diese wuchtiger und somit eindrücklicher wirken zu lassen. Sowohl textlich wie auch zeichnerisch lassen die beiden Gemälde eine tiefe Auseinandersetzung mit der ausgewählten Fragestel-lung sowie der Analyse im Theorieteil erkennen.